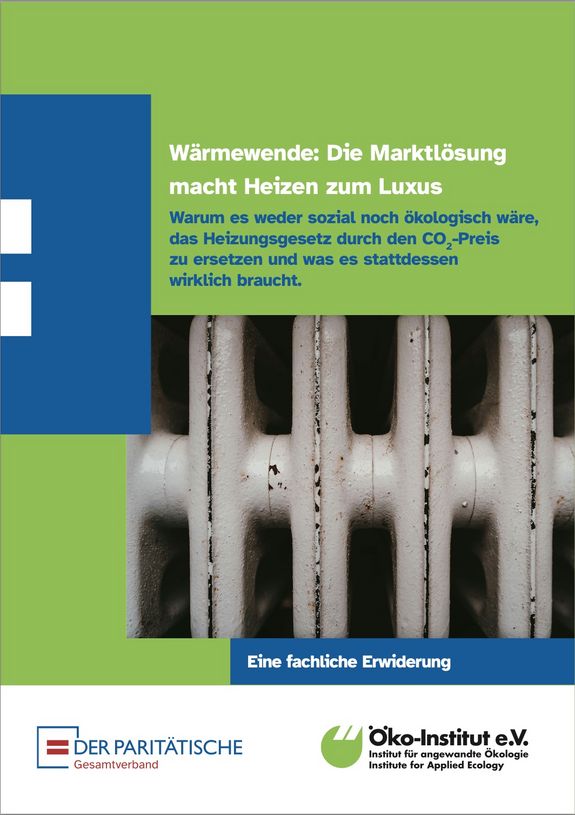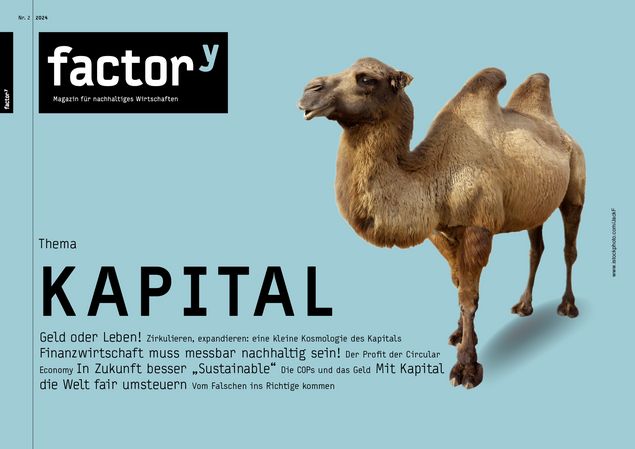Der Gebäudesektor ist wegen seines nach wie vor hohen Energieverbrauchs durch die fossil dominierte Wärmeproduktion einer der problematischsten Bereiche für Klimaschutz und Energieabhängigkeit – nicht nur in Deutschland.
Aber in Deutschland hatte 2023 das politische Design der Wärmewende zunächst ohne soziale Komponente eine "grüne" Partei fast zweistellige Zustimmungswerte gekostet. Der mittelfristige Ausstieg aus den fossilen Heizungssystemen, die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) war diskreditiert, bevor sie überhaupt bekannt war. Eine von konservativer und rechter Seite angeheizte medial gestützte Gegenbewegung führte zu einer enormen Verunsicherung in Großteilen der Bevölkerung – und zu seitdem dauerhafter Ablehnung jeglicher entsprechender Maßnahmen.
Die Wärmewende wurde zum rechtspopulistischen Kampfbegriff, schreibt Andres Friedrichsmeier im factory-Magazin Design. "Das GEG gehört zu den unbeliebtesten Projekten der Bundesregierung", fasst Johannes Hillje in seiner Medienanalyse zum GEG 2024 zusammen. Doch das Akzeptanzdefizit bei einem der bedeutendsten Klimaschutzvorhaben der 20. Legislaturperiode müsse sich die Bundesregierung in erster Linie selbst ankreiden.
"Insgesamt ist das GEG ein Beispiel dafür, wie man eine anspruchsvolle Klimaschutzmaßnahme als Regierung nicht konzipieren und kommunizieren sollte." Das sei die Lehre daraus für ein wirksames Design der Transformation. Allerdings sei auch die demokratische Opposition ihrer Verantwortung für einen faktenbasierten Diskurs nicht immer gerecht geworden, formuliert Politikberater Hillje.
Markt statt Gesetz?
Nun stellt sich aber genau diese damalige Opposition auf, die Bundestagswahl 2025 zu gewinnen. Mit einem Programm, das bei Klima- und Ressourcenschutz, bei Sozialem und Bildung, weit hinter dem Notwendigen zurückbleibt.
Darin wirbt die CDU für sich, dass sie das "Heizungsgesetz abschaffen" will. Setzen sich CDU und FDP mit ihren Vorstellungen durch, würde das Gesetz gekippt. Sie kündigen stattdessen eine reine Marktlösung an, die mit höheren CO₂-Preisen für die Brennstoffe den Heizungsaustausch voranbringen sollen.
Der soziale Ausgleich, das so genannte Klimageld, das auch schon die Ampelkoalition angekündigt hatte, aber nicht umsetzte, bleibt auch bei den Anhängern der reinen Marktlösung unbestimmt.
"Dann aber drohen drastische Mehrkosten für Haushalte" so das Fazit einer gemeinsamen Studie zur Sozialen Wärmewende des Öko-Instituts und des Paritätischen Gesamtverbands: „Heizen würde zum Luxus!“
Hoher CO2-Preis als Ersatz für Gesetz würde alle belasten
Laut Studie wäre ein CO₂-Preis von 524 Euro erforderlich, damit die CO2-Emissionen genauso stark sinken, wie sie es durch das Heizungsgesetzes bis 2030 voraussichtlich tun. Dies würde bei Gas zu einem zusätzlichen CO₂-Kostenaufschlag von 10,52 Cent pro kWh führen – das entspricht einer Verdopplung des Gaspreises.
Die finanziellen Folgen für Haushalte wären enorm. Einige Beispiele:
• Ein Haushalt im Wohneigentum mit bisherigen Heizkosten von 1.000 € pro Jahr müsste mit zusätzlichen Heizkosten von 887 € jährlich rechnen.
• Eine vierköpfige Familie mit Heizkosten von 3.000 € pro Jahr käme auf 2.660 € zusätzliche Heizkosten.
• Durchschnittlich sind für Haushalte mit Gasheizung im eigenen Haus jährliche Mehrkosten von fast 1.500 € zu erwarten.
• Mieter*innen in einem Gebäude der Effizienzklasse G mit 3.000 € Heizkosten pro Jahr müssten mit zusätzlichen CO₂-Kosten von 532 € jährlich rechnen.
Der Unterschied im Geltungsbereich einer solchen Regelung bzw. Nicht-Regelung ist gravierend: Denn während die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes zum Einbau von 65 Prozent erneuerbare Energien nur diejenigen betreffen, die ihre Heizung erneuern müssen, würde ein hoher CO₂-Preis dagegen alle Haushalte belasten – auch jene, die ihre Heizung erst kürzlich ausgetauscht haben und daher keine kurzfristige Wechselmöglichkeit haben.
Wärmewende mit sozialem Ausgleich gefordert
Die Studienautor*innen plädieren angesichts dieser Ergebnisse für eine soziale Wärmewende anstelle einer reinen Marktlösung. In der sozialen Wärmewende würden gezielte Entlastungen, Förderung und Schutzmaßnahmen für Mieter*innen sowie Anreize für Heizungsindustrie, Stadtwerke und Kommunen kombiniert.
Die Expertise des Öko-Instituts und des Paritätischen enthält dazu umfassende Vorschläge für sozial gerechte Entlastungen und Förderungen, für mehr Schutz der Mieter*innen und zur Entfachung zusätzlicher Dynamiken bei Heizungsindustrie, Stadtwerken und Kommunen.
Ein Beispiel ist etwa das Social Leasing: Wärmepumpen könnten durch Ratenzahlung leichter zu finanzieren sein, wobei einkommensabhängige Förderungen gezielt Haushalte mit wenig Einkommen unterstützen. Weiterer Vorteil: Das Leasing-Modell umfasst nicht nur das Gerät, sondern auch Monitoring, Wartung und Instandhaltung – das senkt zusätzliche Hürden.
"Wer alles über den CO₂-Preis regelt, produziert soziale Verwerfungen und Ausschlüsse, die auf Ablehnung und Unverständnis stoßen müssen", sagt Dr. Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. "Wir brauchen eine soziale Wärmewende, die gleichermaßen für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit steht."
Malte Bei der Wieden, Experte für die Wärmewende am Öko-Institut weist auf das sich schließende Zeitfenster hin: „Heizungen halten mindestens 20 Jahre. Wenn wir jetzt aufhören, neue Gas- und Ölheizungen einzubauen, können wir das Klimaziel 2045 noch erreichen. Das Heizungsgesetz ist dafür essenziell.“
“Gerechte Kompensation statt Rückabwicklung”
Zustimmung zum Festhalten an Klimaschutz und Gebäudeenergiegesetz kommt auch von einem der profundesten Vertreter des CO2-Preises. Der Ökonom Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, warnt in der Osnabrücker Zeitung vor einer Rücknahme des "Heizungsgesetzes" und plädiert für eine gerechtere Gestaltung.
"Es braucht keine Rückabwicklung, sondern es muss vorrangig eine wirksame und gerechte Kompensation geschaffen werden", sagte Edenhofer der Zeitung. Es solle aber keine pauschale Pro-Kopf-Rückerstattung nach Einkommen sein, sondern eine Kompensation, die sich nach dem energetischen Standard des Gebäudes richtet.
Diese Rückerstattung müsse dann abgeschmolzen werden, sodass Druck entstehe, die Sanierung oder den Heizungstausch anzugehen, zitiert das ZDF Edenhofer.
"Schon 2027 - also in zwei Jahren - wird sich der CO2-Preis für das Heizen mit Gas und Öl genau wie für das Autofahren mit Diesel und Benzin nicht mehr über ein deutsches Gesetz, sondern über den europäischen Emissionshandel bilden." Laut Studien könnte dann der CO2-Preis auf bis zu 200 € pro Tonne CO2 steigen – sie schlagen ein vermögensabhängiges Abschmelzen des Ausgleichs vor.
Laut Edenhofer brauche es daher die klare Ansage der Politik, dass das Heizen mit Öl und Gas zur steigenden Belastung werde.
Wirkungsvoll ist nur sozial gerecht
Der Wirtschaftswissenschaftler Edenhofer gilt im konservativ-neoliberalen Ökonomie-Verständnis gern als Stimme für mehr CO2-Preis statt Ordnungspolitik, sein Plädoyer für konsequente CO2-Bepreisung dürfte auch der CDU/CSU-Losung “Markt statt Gesetz” nutzen.
Doch schon 2015, lange vor der Einführung des CO2-Preise für Brennstoffe, forderte er in einem Beitrag für das factory-Magazin Schuld & Sühne die sozial gerechte Gestaltung steigender Preise.
Die Wissenschaftler*innen seines Instituts weisen immer wieder in Studien auf die Notwendigkeit und Machbarkeit der gerechten Gestaltung des CO2-Preises und vor allem deren deren besserer Wirksamkeit für Klimaschutz hin. Was wirklich wirkt, ist eine Mischung ordnungspolitischer Maßnahmen mit Steuer- und Preisanreizen.
Mehr dazu in den beiden factory-Magazinen Kapital und Wohlstand. Mehr zur besseren Gestaltung politischen Designs findet sich im factory-Magazin Design.