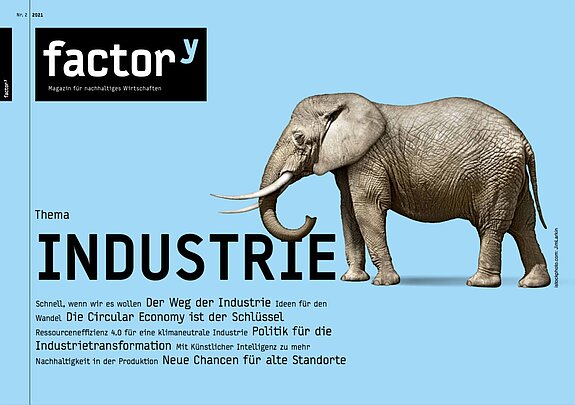Industrie

Der Weg der Industrie
Heute werden nahezu sämtliche Waren in Massen mit Standardverfahren produziert. Seit zwei Jahrhunderten gilt „die Industrie“ als Synonym für Wohlstand und Arbeitsplätze. Sie ist aber gleichzeitig auch historischer Umweltverschmutzer – mit riesigem Potenzial für klimagerechtes Umsteuern. Der Blick darauf, wie oft sie sich bereits gewandelt hat und was „Industrie“ eigentlich ausmacht, führt in noch heute wirksame Verstrickungen unserer Weltsicht in die Welt von Kohle und Stahl.
Von Andres Friedrichsmeier
Die Geschichte des Industriezeitalters wie üblich ausgehend von der Dampfmaschine zu erzählen, führt gleich zu Beginn zu Überraschungen. Da ist einerseits die zeitliche Parallelität der mit Kohle befeuerten Mechanisierung der Produktion und einer spektakulären Umwälzung der Gesellschaften. Diese waren bis dato im wesentlichen zunächst agrarische und im modernen Sinne noch nicht wirkliche Nationalstaaten. „Alles Ständische verdampft“, kommentierte der Promi-Philosoph jener Zeit, Karl Marx.
Doch warum kam die „industrielle Revolution“ so spät? Schließlich war Dampfkraft seit der Antike bekannt und die berühmte Erfindung von James Watt lediglich eine Verbesserung bereits vorhandener Konstruktionen. Kohleabbau wurde in England oder dem Ruhrgebiet schon im Mittelalter praktiziert. Obwohl also technologisch nicht wirklich neu, gilt die kohlegetriebene Dampfmaschine dennoch bis heute als Paradebeispiel für die revolutionierende Kraft von Technologie. Ihr Rattern und Schnaufen hallt in unseren Köpfen nach, wenn wir hoffen oder bangen, Künstliche Intelligenz, Kreislaufwirtschaft oder dezentrale Ökostromerzeugung mögen die Welt klimaneutral machen.
Allerdings: Dass Technikinnovation nicht der alleinige Auslöser der Industrialisierung gewesen sein kann, lässt sich natürlich keine gute Geschichtslehrerin und kein Museumspädagoge entgehen – die meisten von uns haben es aber halb wieder verdrängt. Warum hat die Relativierung der Führungsrolle der Technologie überhaupt ein didaktisch nutzbares Überraschungspotenzial?
Das Resümee dieser Untersuchung vorwegnehmend: Nur wenige Generationen Industriezeitalter haben unserer Weltsicht derart den Stempel aufgedrückt, dass es sogar unsere Sicht auf die Periode selbst prägt. Ein genauerer Blick auf das, was Industrie eigentlich so kennzeichnet, hilft uns zu kontrollieren, mit welcher stark industriell geprägten Brille wir unsere Zukunftsoptionen betrachten, und das in einer zunehmend postindustriellen Welt.
Am Anfang war nicht allein die Dampfmaschin’
Dafür zunächst zurück zur Dampfmaschine, in eigentlich nur in Deutschland üblicher Diktion also zur „Industrialisierung 1.0“, in das England der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der bereits erwähnte Geschichtslehrer oder die Museumspädagogin würden uns auf die kurz vorher einsetzende Bevölkerungsexplosion hingewiesen haben. Die bewirkte gleichzeitig Nachfrageschub und freies Arbeitskräfteangebot. Zusätzlich kombiniert mit neuen Rohstoffflüssen aus den Kolonien entstand damit ein Hebel, um die eingespielten ständischen Produktionsstrukturen aufzusprengen. Zu letzteren gehörten bereits Manufakturen als eine Art Frühstufe der Massenfertigung.
Die ab dann einsetzende selbstverstärkende Dynamik meinen wir meist, wenn wir von „Kapitalismus“ sprechen. Oder wenn wir mit Klimasorgen auf eine nahezu unverändert von fossiler Energie abhängige Weltwirtschaft blicken. Global betrachtet haben Wachstum und CO2-Ausstoß bis heute einen nahezu analogen Kurvenverlauf. Denn auch wenn postindustriell werdende Industrieländer die mit ihrer Konsumweise zusammenhängenden Umweltfolgen nationalstatistisch ausblenden, weil sie schmutzige Produktionsteile an billigere Auslandsstandorte verlagern, bleiben sie damit weiter Mitverursacher steigender globaler Emissionen.
Anregend an der Geschichte industrieller Revolutionen ist, dass wir an nahezu jeder Stelle auf Verschränkungen von Fortschritt mit Rückschritt stoßen – wir bekommen sozusagen kognitive Dissonanz in der Dauerschleife. Heute, da unsere Fortschrittsfahrt auf die Wand von Klima- und Biodiversitätskrise zusteuert, verblüfft in der historischen Rückschau, dass im Mittelalter beispielsweise Arbeitszeiten überwiegend kürzer waren als unsere gegenwärtigen. Oder dass mit der industriellen Revolution 1.0 die durchschnittliche Lebenserwartung und Körpergröße der Menschen einen kräftigen Sprung nach unten gemacht hat.
Aber es geht noch weiter: Ab 1970 erkämpfte Lockerungen von der vormals überstrengen Arbeitsdisziplin gingen einher mit der Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen und dem erhöhtem Druck auf den Einzelnen, selbst eine Optimierung und Vermarktung seiner Arbeitskraft zu bewerkstelligen. „Burn out“ war früher unbekannt und Depression keine Volkskrankheit. Eigentlich stellen wir uns Fortschritt weniger widersprüchlich vor.
Ebenfalls interessant: Eine in der Umweltbewegung viel beachtete Neuinterpretation der Dampfmaschinengeschichte stammt vom schwedischen Humanökologen Andreas Malm 2016 (Fossil Capital, 2016). Malm arbeitet heraus, dass ein treibendes Moment der schon vor der Dampfmaschine aufgekommene Wunsch der Kontrolle der Arbeitskraft war. Seine lesenswerte Indiziensuche zeigt, dass es bei der Industrialisierung immer auch um Machtfragen und eine ausgeprägt politische Seite ging. Die Brutalität der Anfangsphase haben natürlich schon viele Autor*innen herausgearbeitet, wichtiger sind aber die Indizien, dass dies bis heute fortwirkt – bis hin zu unseren heutigen Schwierigkeiten, den Gewaltkurs gegen unsere eigene Zukunft zu korrigieren.
Macht macht Standards und Masse
Zur Gewaltförmigkeit der Anfangsphase gehören Kinderarbeit, die Enteignung gemeinschaftlich bewirtschafteter Flächen in den Dörfern und erzwungene Binnenmigration. Die spätere Zähmung der Arbeitskämpfe durch sozialpolitische Kompromisse wiederum wurde substanziell gestützt und erkauft durch die Zementierung der Unterordnung von Frauen sowie die brutale Ausplünderung der kolonialisierten Welt.
Soziale Rechte und Kolonialwaren hier, Zwangsarbeit dort. Dass England Startpunkt der Industrierevolution wurde, liegt fraglos auch an seiner Kolonial- und Seemachtstellung, ferner an der schon weiter vorangeschrittenen Nationalstaatsbildung.
Im kleinstaatenzersplitterten Deutschland mit seiner Last der Zölle und dem Chaos uneinheitlicher Währungen, Gewichts- und Längenmaße müssen die ersten Industriellen viel härtere Lobbyarbeit leisten: Für die Aufhebung der Leibeigenschaft und Zünfte, für die Nationalstaatsgründung, für Schutzzölle und ein einheitliches Bankenwesen.
Nationalstaat und Industrie werden miteinander groß, verfolgen verschränkte Interessen und eine in Teilen ähnliche Logik, darunter die Bürokratie, auch wenn die heute oft nur noch beim Staat vermutet wird. Naomi Klein (This Changes Everything, 2014), sieht darin sogar eine Klimachance: Wie schnell eine Industrieproduktion umgepolt werden kann, haben die USA im zweiten Weltkrieg mit der Umstellung auf Kriegswirtschaft demonstriert.
Das gelang ohne Aufhebung von Kapitalismus, aber mit deutlich planwirtschaftlichen Elementen und zustimmungsfähig gemacht mit einem Schub bei der sozialen (Steuer-)Gerechtigkeit. Zum Vergleich: In seinem 2011er-Gutachten fordert der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen einen neuen „Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“.
Schließlich ist das Wesen der Industrie ihre Wandelbarkeit. Historisch hat sie ihre Form bereits mehrfach verändert: Zunächst ermöglicht die Dampfkraft Maschinen, die wiederum Produktionsschritte automatisierbar machen. Genau dies markiert den maßgeblichen Unterschied von Handwerk und Industrie.
Der nächste technologische Umbruch kommt mit dem Fließband („Industrialisierung 2.0“). Erst mit ihm, also lange nach Marx, tritt die eigentliche Grundform von Fabrikarbeit auf den Plan, ebenso der Manager-Kapitalismus. Beim Fließband, identifiziert mit Henry Ford ab 1913, ist es wieder so, dass Ford lediglich vorherige Konstruktionen verbessert.
Elektrisiert, fließend und geteilt
Technologisch noch entscheidender ist aber vermutlich die Elektrizität, denn eine größere Stückzahl dampfgetriebener Maschinen in einer Werkshalle zu betreiben ist äußerst schwierig. Der Durchbruch erfolgt wieder im Tandem mit sozialen Erfindungen, die Fords Fließband zeitlich sogar vorangehen. Heute assoziieren wir sie mit Frederick Taylor.
„Taylorismus“ bezeichnet die wissenschaftsbasierte Aufgliederung von Arbeit in zeitoptimierbare monotone Teilschritte. Von der Logik her ist dies durch und durch bürokratisch. In diesem Modell legt der Fabrikarbeiter in der Werksumkleide seinen Intellekt zusammen mit der Straßenkleidung ab und nimmt ihn auch erst wieder auf, wenn die Werksirene tönt, fasste es Antonio Gramsci zusammen. Die hier angelegte radikale Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit, von blue collar versus white collar, ist offensichtlich auch soziale Machttechnik, gar nicht unabhängig vom Wunsch nach Kontrolle von Arbeitskraft verstehbar. Zusammen mit Technologien wie dem Fließband hat sie sich zu einem Disziplinarregime ausgeformt, das bis in die 1960er-Jahre vorherrscht.
Wir sind jetzt übrigens an dem Punkt, von wo wir rückblickend erahnen, wie historisch überhaupt je Zwangsarbeit als vorgeblich erzieherisch motiviert ausgegeben werden konnte: Ob in den europäischen Kolonialreichen, in der Sowjetunion für politisch Unbequeme, in Institutionen wie dem damalige Zuchthaus und, wie sich retrospektiv zeigt, erstaunlich lange fortlebend in der Erziehungskultur etlicher Waisenheime.
Der dunkle Schatten von Industrie 2.0 ist also nicht bloß Umweltzerstörung, sondern auch ein einst parallel mit ihr aufgekommenes Gesellschaftsideal, nach welchem die Menschen, Zahnrädern gleich, sich möglichst diszipliniert in einem großen Gesamtkörper zusammenschalten, unter einer möglichst eindeutigen Gesamtführung. Es gibt ein analoges Organisationsideal für die Industriefabrik und für die metaphorische Großfabrik der Nation. Dieses Ideal hat auch viele weitere Bereiche geprägt, etwa die Industrialisierung von Landwirtschaft oder das Gesundheitswesen und wirkte, bösen Zungen zufolge, selbst in die Hochschulreformen 1960ff hinein.
Das Modell altert digital
Kaum fünf Jahrzehnte nach „2.0“, also etwa in den 1970ern, setzt die industrielle Revolution „3.0“ an, jedenfalls gemäß der in Deutschland durch industrienahe Kreise erfundenen Zählweise. Sie wird technologisch mit dem Computer identifiziert. Ob Computer damals tatsächlich verbreitet genug waren, um Arbeitsabläufe zu revolutionieren, ist eine berechtigte Frage. Davon unabhängig sind sich fast alle einig, dass es, beginnend mit den 1970ern, eine weitere Umwälzung in den Arbeitswelten gab.
Ob man sie „nur“ als eine industrielle Revolution sehen will, oder bereits als eine weg vom Industriemodell, bleibt eine weitere Frage. Für die bis dato als „Industrieländer“ bezeichneten Staaten wird ab den 1970ern auch der an Beschäftigtenzahlen klar ablesbare Strukturwandel zur „Dienstleistungsgesellschaft“ festgemacht. Jener Wandel bedeutet definitiv mehr als der bloße Ausdruck von Produktionsverlagerung ins Ausland.
Selbst in China sinkt der Anteil der Industriearbeitsplätze längst. Autor:innen mit ausgeprägt industrieller Weltsicht lassen das nicht gelten, schließlich würden viele Dienstleistungen in industrielle Produkte einfließen. Sie glauben fest, die Grundlage aller echten Werte entstehe nur in bezahlter Arbeit, bei der stoffliches Material umgewandelt wird.
Auch in unseren Köpfen schwingt diese Vorstellung mit: Ist nicht Geldschöpfung von Banken rein fiktive Wertschöpfung? Und das Gehalt für eine Dienstleistung, etwa die einer Krankenschwester, immer erst einmal mit materieller Industriearbeit zu „erwirtschaften“? Dagegen zu argumentieren gilt als nahezu aussichtslos.
Abstrakt ist uns allen klar, dass eine industrielle und materialgebundene Produktion, etwa von Raketen oder SUV im Unterschied zur Arbeit der Krankenschwester menschliche Wohlfahrt überhaupt nicht befördert.
Eigentlich wissen wir auch, dass die angesprochene Wertschöpfung letztlich eine rein soziale Konstruktion ist. Soziale Konstruktion meint natürlich nicht, dass ein einzelner entscheiden könnte, auf Zuruf sei anders zu konstruieren. Sondern dass etwas erst aus dem Zusammenwirken sehr Vieler und dem sozialen Sinn entsteht. Solange wir aber Wohlstand mit Industrie identifizieren, was aufgrund der Geschichte in Deutschland eine besonders breite Verankerung hat, bleibt für uns jede alternative Art der Schöpfung von Werten unplausibel.
Überzeugt statt abgeschaut
Der Höhepunkt des Industriezeitalters ist spätestens gegen 1970 anzusetzen. Danach gelang in den anderen Ländern der Welt, etwa vormaligen Kolonien, nur noch selten erfolgreiche Industrialisierung. Das sah bei denjenigen Ländern, die zwei Generationen früher damit angefangen hatten, spürbar anders aus: Opel hatte 1972 mit fast 60.000 Beschäftigten die vierfache Belegschaft von heute. Reden wir über die Zeit danach, kommen wir nicht mehr vorbei an einer Auseinandersetzung mit dem, was „Industrie“ eigentlich wirklich ausmacht.
Immerhin unstrittig ist, dass wir dieser kurzen Periode noch heute wirksame Grundüberzeugungen verdanken. Und nur, weil sie aus jener Periode stammen, sind sie nicht automatisch falsch. Dass es aber keine naturgegebenen Einsichten sind, sieht man allein daran, dass sie anderen Gesellschaften kaum verständlich gewesen wären, ja absurd geklungen hätten, etwa in der Antike oder im Mittelalter. Ein paar Beispiele:
- Ohne ewiges Wachstum funktioniert es nicht.
- Die Grundlage aller echten Werte entsteht in bezahlter Arbeit, bei der stoffliches Material umgewandelt wird.
- Der moderne Mensch verwirklicht sich in formaler Arbeit und ihrer Komplementärwelt, dem Konsum.
- Demokratische politische Willensbildung kann nur funktionieren, wenn der Nationalstaat ihre zentrale Bühne ist (ersatzweise eine zur Republik werdende EU).
Diese Grundüberzeugungen sind bei vielen von uns fest verankert – gleichzeitig setzt sich mehr und mehr die Ahnung durch, mit diesem Mindset schlecht gerüstet zu sein für Herausforderungen planetaren Ausmaßes – etwa der Klimakrise. Maja Göpel, eine der bekanntesten Ökonominnen der Umweltbewegung und Mitglied des Club of Rome, fordert vor ähnlichem Hintergrund daher einen „Great Mindshift“ (2016).
Das neue Arbeiten
Zurück zur Frage, was – wenn schon keine rein industrielle Revolution 3.0 – in den 1970er Jahren passiert ist. Dieser Zeitraum steht, neben seiner Ablehnung von (Fabrik-) Disziplin, auch für die Entdeckung der Kraft intrinsisch motivierten Arbeitens. Bestehende bürokratische Instrumente zur Kontrolle von Arbeitskraft werden von neuen abgelöst, teilweise treten auch einfach zusätzlich neue hinzu: Ziel- und Leistungsvereinbarungen, Management by Objectives, Gruppen- und Projektarbeit, um ein paar zu nennen.
Zunehmend wird der Wert von Konsumprodukten kulturalisiert, also beispielsweise der Statuswert nicht mehr durch zusätzliche Zylinder und dickeren Motor, sondern mit Design und Product Placement auf Hiphop-Konzerten erhöht. Die wesentliche Wertschöpfung beispielsweise bei einem Adidas-Turnschuh entsteht nicht mehr beim stofflichen Akt des Zusammenklebens von Gummi, sondern beim Design, in einer Marketingstruktur und so weiter.
Im Unterschied dazu spielte für die Industrie 2.0 noch die „Economy of Scale“ die entscheidendere Rolle. Hier liegt ganz offensichtlich ein hohes Potenzial für die Abkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch – allein die Erkenntnis dessen ist noch zu wenig verbreitet.
Die Bank produziert
Für einen weiteren Revolutionsanwärter, der sich zwei weitere Jahrzehnte später bemerkbar macht, hat die deutsche „Industrie x.0“-Zählung gar keine Entsprechung: die Finanzialisierungvon 1990ff. Hierzu gehört die Erkenntnis, dass Finanzmarkt- oder Shareholder Value-Kapitalismus den traditionellen Manager-Kapitalismus abgelöst hat. Das meint so wenig das Verschwinden der Manager*innen, wie „postindustriell“ ein Verschwinden von Industrie bedeutet.
Kern ist, dass Aktienkurse und Marktbewertungen immer direkter in die Industrieunternehmen hineinwirken. Und wo das nicht geht – Unternehmen haben bestenfalls einen Aktienkurs, aber immer mehrere Unternehmensabteilungen – werden auf Basis von Kennzahlensystemen unternehmensinterne Quasimärkte konstruiert. Sie setzen interne Abteilungen untereinander in eine künstliche Konkurrenz, abgebildet in Leistungskennziffern, manchmal auch einem unternehmensinternen Preissystem.
Eine andere Seite ist das Outsourcing. Nachdem jahrzehntelang Wertschöpfungsanteile in die Fabrik hinein geholt wurden, schlägt nun die Stunde der flexiblen Zulieferkette. Dass all dies eine industrieferne Logik ins Spiel bringt, zeigen Klagen von Gewerkschafter*innen, u. a. Siemens habe sich in eine Bank mit angeschlossener Produktion verwandelt.
Weiter geht es zur industriellen Revolution 4.0, technologisch identifiziert mit umfassender Vernetzung bzw. dem Internet of Things. Sie ist erst im Entstehen und sie scheint jenen Plattform-Kapitalismus hervorzubringen, wie er laut ihrer Kritiker*innen von Amazon, Google, Uber und Co. praktiziert wird. In der Art und Weise, wie in Industrie 4.0 Arbeitskraft kontrolliert wird, sehen Autor*innen einen Trend zu dezentralen Entscheidungen.
Auch die vierte Revolution ist also eine spürbare Kurskorrektur zu der ursprünglichen industriellen Logik. Hierbei ist Dezentralität übrigens nicht mit Selbstbestimmung zu verwechseln, eher ist daran gedacht, dass KI-Systeme Entscheidungen übernehmen, es aber dezentral Instanzen mit Menschen geben muss, die das Wirken der KI lokal korrigieren – wie Lieferant*innen, Packer*innen, Programmierer*innen.
Mit Logik hat das nichts zu tun
Selbst wenn also spätestens ab dem Punkt „3.0“ nur noch eingeschränkt von industrieller Logik die Rede sein kann, verschwindet die Industrie offenkundig auch am Punkt 4.0 nicht. Warum sollte sie, schließlich hat ja auch der Agrarsektor die Agrargesellschaft überlebt. Allerdings denken wir kaum noch agrarisch, aber weiterhin zu industriell. Die beschriebenen Schritte weg von industrieller Logik haben leider keinen ausreichend klaren Abzweig von unserer Fortschrittsfahrt gegen die Wand der Klima- und Biodiversitätskatastrophe gezeigt.
Industriegeschichte zu erzählen, gar als Linie 1.0 bis 4.0, verleitet offenbar immer zur Überschätzung von Technologie. Heute erscheint uns instinktiv wahrscheinlicher, dass eine neue Technik die Welt umkrempelt, als eine soziale Leitidee wie climate justice oder degrowth.
Erscheinen heute neue Herausforderungen am Horizont, hoffen wir als erstes auf technische Reparatur. In der Klimadebatte gibt es dafür den Begriff des „techno fix“ – auf ihn wird lieber gesetzt als auf die Möglichkeit, politisch und absichtsvoll Veränderungen zu verabreden.
Analog zur Rolle des Elektroautos in der Klimadebatte war beispielsweise auch die Covid-Debatte von „techno fixes“ wie umfassenden Tests und Luftfiltern dominiert.
Was nicht automatisch falsch sein muss; man vergleiche nur einmal, wie wenig sich die Verfassung der USA seit ca. 1791 verändert hat, während die Bevölkerungszahl um das 80-fache gewachsen ist. Ökonomisch, kulturell und sozial hat die heutige USA kaum noch etwas mit den Sklavenhalter- und Puritaner-Communities von damals gemein – außer jener Verfassung. Obwohl eine Demokratie, haben beim zwischenzeitlichen Umkrempeln fast aller gesellschaftlichen Grundstrukturen absichtsvolle demokratische Kursentscheidungen demnach nicht die größte Rolle gespielt.
Aber: Der Gang durch die Industrieentwicklung zeigt, dass radikale Kurswechsel möglich sind, wenn mehrere Dynamiken in einer neuen Konstellation zusammenfinden und sich gegenseitig verstärken: Technologie, Macht, soziale Ideen und soziale Bewegungen.
Dr. Andres Friedrichsmeier ist Soziologe und arbeitet im Thüringer Bildungsministerium. Zuletzt stellte er sich im factory-Magazin Vielfalt (1-2021) die Frage, woher der Widerwille gegen kulturelle Vielfalt und offene Gesellschaft kommt.

Das factory-Magazin Industrie lässt sich als PDF im Querformat auf allen Bildschirmen inklusive Smartphone und Tablet lesen. Das Magazin ist reich illustriert und enthält weitere Zahlen, Zitate und Wordcloud zum Thema. Enthalten sind dort alle Beiträge, im Online-Themenbereich erscheinen sie nach und nach – lassen sich dort aber kommentieren und bewerten. Der Download des factory-Magazins ist wie immer kostenlos.
Beiträge online
INDUSTRIE

- Editorial: Schnell, wenn wir es wollen
- Der Weg der Industrie
- Ideen für den Wandel
- Die Circular Economy ist der Schlüssel
- Ressourceneffizienz 4.0 für eine klimaneutrale Industrie
- Politik für die Industrietransformation
- Neue Chancen für alte Standorte
- Mit Künstlicher Intelligenz zu mehr Nachhaltigkeit in der Produktion
News zum Thema
- 12/2025 | Firmenflotten als Schlüssel: Wie Europas Elektromobilität voran käme
- 12/2025 | Mit Fakten für Veränderung: 20 Jahre factory-Magazin
- 11/2025 | Klimaschutzpläne für 2035 begrenzen Erderhitzung nur auf 2,6 Grad Celsius
- 07/2025 | EU-Ziel für Verbrenner-Neuzulassungs-Stopp 2035 sichert Arbeitsplätze
- 06/2025 | CO2nferenz NRW: Wie Unternehmen Bilanzierung und Regulierung nutzen können
- 06/2025 | Für 70 Euro pro Monat ein E-Auto leasen
- 05/2025 | Expertenrat: Puffer im Emissionsbudget bis 2030 gering, Klimaziele 2030 bis 2045 so nicht erreichbar
- 04/2025 | Koalitionsvertrag 2025: Weniger Schutz für Menschen, Klima und Umwelt, dafür mehr Ungleichheit
- 04/2025 | BIP-Prognose 2025: US-Zölle drücken deutsches Wirtschaftswachstum
- 02/2025 | Expertenrat Klima: Seit 2022 mehr Energiewende, aber kein Umbau bei Verkehr, Gebäude, Landnutzung und gerechter Lastenverteilung
- 01/2025 | Erneuerbare Energien sorgen für günstigere Strompreise und geringere Treibhausgasemissionen
- 07/2024 | Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie auf dem Weg
- 07/2024 | Circular Design Summit mit offiziellem Start des Circo-Hub
- 06/2024 | Expertenrat Klima zur Einhaltung des Klimaziels bis 2030
- 05/2024 | Wie Unternehmen Circular Economy umsetzen können
- 04/2024 | Klimawandel führt zu Einkommensverlusten
- 03/2024 | Emissionsintensive Chemieparks in Deutschland und Wege zur Emissionsreduktion
- 02/2024 | Klimastreik für mehr Nahverkehr und bessere Arbeitsbedingungen
- 02/2024 | Bundespreis Ecodesign 2024: Bewerben bis Mitte April
- 01/2024 | Treibhausgasbilanzen für die Unternehmensberichterstattung
- 01/2024 | Der andere Bauernprotest: Tausende fordern bäuerliche und ökologische Landwirtschaft
- 01/2024 | Deutschlands CO2-Emissionen sanken 2023 auf Rekordtief
- 12/2023 | Deutschlandpakt zur Planungsbeschleunigung erhält NABU-Negativpreis "Dinosaurier des Jahres"
- 12/2023 | Effizienz-Preise NRW für Elektronik-Refurbisher, Fliesenretter, Blaulicht-Lebensverlängerung und faires Lötzinn
- 12/2023 | Bundespreis Ecodesign 2023 prämiert zwölf Vorreiterprojekte für ökologische Produkte und Services
- 11/2023 | Öl- und Gaskonzerne könnten für Klimaschäden zahlen und dennoch profitieren
- 09/2023 | Circular Design Summit stellt zirkuläre Produkte und Geschäftsmodelle vor
- 06/2023 | Fahrradwirtschaft: Starkes Wachstum bei Umsatz und Beschäftigung
- 05/2023 | Subventionierte Industriestrompreise führen nicht zu klimaneutraler Produktion
- 05/2023 | UN: Schutz der biologischen Vielfalt zügig umsetzen
- 05/2023 | Vollzeitarbeitende wünschen sich Viertagewoche
- 04/2023 | Weitere Studie: E-Fuels nicht sinnvoll für großflächigen Einsatz bei Pkw und Lkw
- 03/2023 | RNE: Mehr Markt im Klimaschutzgesetz gefährdet gesellschaftlichen Zusammenhalt
- 03/2023 | "Letzte Warnung" des IPCC: Schnelle Emissionsreduktion nötig – und möglich
- 03/2023 | Deutsche Treibhausgasemissionen sanken 2022 um 1,9 Prozent – nötig wären sechs Prozent
- 03/2023 | Ressourcenschutz durch Reparatur: Bereitschaft da, Hürden zu hoch
- 03/2023 | Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen können Milliarden Schadenskosten vermeiden
- 01/2023 | Bundespreis Ecodesign startet Wettbewerb 2023
- 01/2023 | Sechs-Punkte-Plan für Gutes Essen für alle
- 01/2023 | Lützerath: Aktionen und Demonstrationen gegen weiteren Braunkohleabbau
- 01/2023 | Lieferkettengesetz: Sorgfalt ist nun Pflicht
- 12/2022 | EU einigt sich auf Gesetz gegen Entwaldung für bestimmte Produkte
- 12/2022 | Bundespreis Ecodesign: Projekte sind Muster für intelligente Lösungsansätze
- 11/2022 | Mit Postwachstum gegen die Polykrise
- 11/2022 | UN-Klimagipfel COP 27: Geplante Maßnahmen reichen nur für 2,5 Grad
- 10/2022 | Beeindruckende Projekte beim Bundespreis Ecodesign
- 10/2022 | Tata bringt günstiges Elektroauto für 10.000 Euro
- 09/2022 | Nachhaltige Unternehmen gehen auf die Straße
- 09/2022 | Globaler Klimastreik für #PeopleNotProfit
- 09/2022 | Schnelle Dekarbonisierung des Energiesystems spart Billionen
- 09/2022 | Unternehmen wünschen sich Regeln, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren
- 09/2022 | Wirtschaft der G7-Staaten auf 2,7-Grad-Kurs der Erderwärmung
- 09/2022 | Digitalisierung muss stärker dem sozial-ökologischen Wandel dienen
- 08/2022 | Mit Übergewinnsteuer Krisenprofite umverteilen
- 08/2022 | Ressourcen schützen heißt Menschen schützen
- 08/2022 | Wie Unternehmen mit KI nachhaltiger wirtschaften
- 07/2022 | Förderprogramm DigiRess zur Digitalisierung der Ressourceneffizienz in zirkulären Produktionsprozessen
- 07/2022 | Earth Overshoot Day 2022 ist Plädoyer für zirkuläre Unternehmen
- 07/2022 | Besser wirtschaften: Kooperativ für Gemeinwohl statt Profite
- 07/2022 | Klimakrise kostete Deutschland seit 2018 etwa 80 Milliarden Euro
- 07/2022 | Das Produktdesign der Klimaneutralität
- 07/2022 | Globaler Holzverbrauch entwaldet den Planeten
- 07/2022 | Unternehmen entwickeln Kreislaufwirtschaft in Kooperation
- 06/2022 | Was Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität beachten sollten
- 06/2022 | Verantwortungsvolle Unternehmen sollten Effizienzgewinne für weiteren Klima- und Ressourcenschutz einsetzen
- 06/2022 | Wie man die eigenen Produkte zirkulär gestaltet
- 05/2022 | Öl- und Gasindustrie setzt weiter auf Expansion statt Transition
- 05/2022 | Land kann Erneuerbare-Energie-Anlagen-Betreiber verpflichten, Bürger*innen zu beteiligen
- 05/2022 | Mit Ökobilanzen zur Ressourcenschonung: Beispiel LED-Leuchten
- 04/2022 | IPCC-Klimabericht zur Minderung des Klimawandels vergleicht Klimaschutzmaßnahmen und ihre Effizienz
- 03/2022 | Stopp russischer Energieimporte würde BIP um drei Prozent reduzieren und Energiewende beschleunigen
- 03/2022 | Globaler Klimastreik für Frieden und Klimagerechtigkeit
- 03/2022 | CO2-Emissionen in Deutschland stiegen 2021 um 4,5 Prozent
- 01/2022 | Das Design bestimmt den Verbrauch: Europaweite Ausschreibung Bundespreis Ecodesign 2022
- 01/2022 | factory-Magazin Industrie: Schneller Wandel ist möglich
- 01/2022 | EU-Taxonomie für Investitionen: Atom- und Gaskraftwerke sollen nachhaltig sein
Themen
- Fakten
- Hürden
- Kapital
- Wohlstand
- Design
- Ressourcen
- Klimaneutral
- Industrie
- Vielfalt
- Change
- Freiheit
- Steuern
- Mobilität
- Digitalisierung
- Besser bauen
- Circular Economy
- Utopien
- Divestment
- Handeln
- Baden gehen
- Schuld und Sühne
- Wir müssen reden
- Rebound
- Sisyphos
- Gender
- Wert-Schätzung
- Glück-Wunsch
- Trans-Form
- Vor-Sicht
- Trennen
- Selbermachen
- Teilhabe
- Wachstum