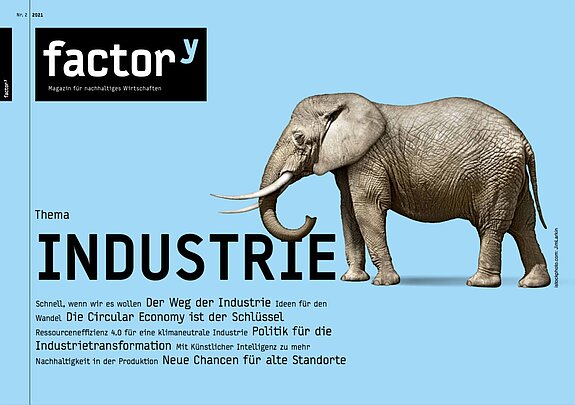Industrie

Ideen für den Wandel
Die energieintensive Industrie zur Erzeugung von Grundstoffen wie Stahl, Zement, Kunststoffen, Aluminium, Papier und Glas ist eine wichtige Säule der Wirtschaft – gleichzeitig verantwortet sie den größten Teil des Umsatzes an Ressourcen und einen hohen Anteil an Treibhausgas-Emissionen. Entsprechende Standorte und Regionen benötigen daher wirksame Lösungen für Dekarbonisierung und Ressourceneffizienz – auch im internationalen Wettbewerb für eine klimaneutrale Industrie. „Grüner“ Wasserstoff gilt neben grünem Strom als Schlüsselelement für die Klimawende der Industrie, benötigt dafür jedoch selbst viel erneuerbare Energie. Prof. Stefan Lechtenböhmer über Möglichkeiten und Anforderungen.
Interview von Ralf Bindel
factory: Für ein klimaneutrales Deutschland bis 2045 steht die Industrie vor einem starken Wandel. Kann sie in dieser Zeit tatsächlich klimaneutral werden?
Stefan Lechtenböhmer: Viele Technologien, die dazu notwendig sind, befinden sich noch in frühen Entwicklungsstadien, andere sind kurz vor der Marktreife. Aber wir haben die Technologien. Wenn wir uns mit staatlicher Unterstützung dahinter klemmen und die nötigen Investitionen tätigen, können wir sie im erforderlichen Maßstab noch schnell genug anwenden. Stahl oder chemische Grundstoffe wie Ammoniak mit Wasserstoff zu produzieren, Kohlenstoffabtrennung beim Zement – technologisch geht es eigentlich.
Was fehlt?
Wir benötigen dazu sehr viel erneuerbare Energie, darunter auch erneuerbaren Wasserstoff. Die Potenziale dafür sind da. Man müsste die gegenwärtigen Zubauraten allerdings mehr als verdoppeln, den Zubau von Wind-off-shore, Wind-on-shore, Photovoltaik massiv beschleunigen. Die Technik ist da, finanzierbar ist es auch.
Was ist dann so schwierig?
Noch ist nicht ganz klar, ob wir die Akzeptanz erhalten für z. B. die On-Shore-Windkraft, wie wir die vielen Photovoltaikanlagen auf die Dächer kriegen und ob es attraktiv genug für die Investoren ist, das zu finanzieren. Hinzu kommen die nötigen Infrastrukturen: ein weiterer Ausbau des Stromnetzes, der zwar geplant ist, aber zu langsam verläuft, und der Aufbau eines Wasserstoffnetzes. Da nimmt man zwar Fahrt auf, aber diese Dinge brauchen Zeit. Außerdem, kann die Industrie die Infrastrukturen und den Ausbau der Erneuerbaren nicht allein umsetzen. Sie benötigt dafür neben der Planung und gesellschaftlichen Akzeptanz eine nicht geringe auch finanzielle Unterstützung vom Staat – was die Bürger*innen ebenfalls akzeptieren müssten.
Über welche Summen sprechen wir?
Es handelt sich um etliche Milliarden Euro. Die Stahlindustrie spricht von 30 Milliarden Euro Investitionen, um komplett klimaneutral zu werden. Hinzu kommen die Kosten für den beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren. Übertragen auf andere Grundstoffindustriebranchen lässt sich in etwa hochrechnen, was auf uns zukommt. Dazu haben wir aber noch keine genauen Zahlen.
Bisher hat sich die Industrie weitgehend über privates Kapital finanziert. Was muss den Bürger*innen eine klimaneutrale Industrie wert sein?
Die Industrie kann zwar aus eigener Kraft sehr viel investieren und neue Investor*innen gewinnen. Aber die kommen nur, wenn sie mit grüner Produktion auch Geld verdienen können. Es wird also eine Mischung aus privatem und öffentlichem Kapital nötig sein.
Die Profite darf die -Industrie dann allein behalten? So wie die Lufthansa nach neun Milliarden Euro Corona-Hilfen?
Es gibt schon Überlegungen der Beteiligung. Man muss wissen, dass die Industrie zwar immer noch profitabel, aber keine Gelddruckmaschine ist. Gerade bei Stahl läuft das Geschäft in stark schwankenden Zyklen. Wir reden hier nicht über BioNtech, die mal eben viele Milliarden Euro Gewinn gemacht haben.
Setzt die deutsche Grundstoffindustrie mehr ins Inland oder ins europäische Ausland ab, oder ist der weltweite Export interessanter?
Das ist unterschiedlich. Wir produzieren in Deutschland z. B. 40 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr, von denen wir selbst gut 30 Millionen Tonnen nutzen. Aber davon geht immer noch der größte Teil in Form von Produkten wie Autos ins Ausland. Gleichzeitig wird mehr als die Hälfte des Stahls, den wir inländisch nutzen, als Baustahl, Autos oder Maschinen importiert. Es gibt also einen sehr intensiven Austausch mit dem europäischen und dem Weltmarkt. Bei Aluminium sieht es ähnlich aus: Wir produzieren ungefähr so viel wie wir nutzen. Trotzdem exportieren wir die Hälfte unseres Aluminiums und importieren etwa die gleiche Menge. Die Weltmarktpreise bestimmen aber immer auch die inländischen Preise. So haben die Stahlüberkapazitäten in China nicht unbedingt zu mehr chinesischem Stahl in Europa geführt, aber zu höherem Preisdruck auf die Stahlhersteller. Vielleicht musste Thyssenkrupp seinen Stahl günstiger an VW verkaufen.
Vor der Klimaneutralitätsaufgabe stehen in den nächsten Jahren sicherlich alle internationalen Industriestandorte. Das heißt doch: Der Druck ist da, ein Preisniveau zu erreichen, das weltweit akzeptiert wird.
Der Druck ist da. Europa will aber Vorreiter sein, auch weil wir international nur mit Premium-Produkten punkten können. Wir sind nicht der billigste Massenanbieter, sondern besetzen das Hightech-Segment. Und in Deutschland sind wir auch Exporteure der dafür nötigen Lösungen, der Technologien. Auch deshalb macht das für uns Sinn. Spannend wird es dadurch, weil auch die anderen dekarbonisieren: Bei den Elektroautos hat China die Nase vorn, ebenso bei manch anderen Technologien.
Machen wir die Industrie in Deutschland oder der EU kaputt, wenn ihre Preise wegen der klimaneutralen Produktionsmethoden steigen?
Höhere Produktionskosten durch Klimaneutralität und höhere Zahlungsbereitschaft der Märkte sollten möglichst im Gleichschritt laufen. Oder man muss Schutzmaßnahmen ergreifen, wie durch den CO2-Grenzausgleichsmechanismus, den die EU einführen will. Das ist aber sehr komplex (siehe Beitrag „Politik für die Industrietransformation im factory-Magazin Industrie). Was sich aber durchaus entwickelt, ist die Idee der so genannten Klimaclubs, in denen sich z. B. die G20-Staaten auf gemeinsame Standards oder gemeinsame CO2-Preise einigen und vorangehen. Denn wenn wichtige produzierende Länder an einem Strang ziehen, braucht man nicht unbedingt einen globalen Emissionshandel, vermeidet aber das Problem des ruinösen Konkurrenzkampfes mit denen, die derartige Randbedingungen noch nicht haben.
Die staatliche Co-Finanzierung des Umbaus benötigen alle Standorte weltweit, ob in Indien, Südamerika oder den USA.
Aber nicht alle können sich soviel leisten wie Deutschland. Andere wiederum können ihre Subventionen besser verbergen. Dann sind die Industrien auch unterschiedlich alt. Die europäische Industrie muss in den nächsten zehn Jahren relativ viel neu investieren. Es ist also dringend. Wer jetzt einen neuen konventionellen Hochofen baut, kann sich ausrechnen, dass er den spätestens in fünfzehn bis 20 Jahren wieder dicht machen muss, weil die CO2-Emissionen der Technologie zu hoch sind. Deshalb kann die deutsche Industrie eigentlich nur noch in klimaneutrale Technologie investieren. Zumindest müssen die Technologien auf Klimaneutralität umgerüstet werden können.
Ist denn eine klimaneutrale Produktion z. B. von Stahl hier überhaupt sinnvoll? Wäre es nicht besser, diesen nah an den Erzvorkommen und Orten mit hoher regenerativer Energieerzeugung zu produzieren und die Vorprodukte in die weiterverarbeitenden Länder zu transportieren?
Vom Ressourceneinsatz her macht es kaum einen Unterschied, wo der Stahl produziert wird. Anders kann es bei der Eisenherstellung aus Erz sein, die ist extrem energieintensiv. Deshalb wird hierfür mit Abstand der größte Teil der Energie benötigt. Die Schweden wollen jetzt statt Erz mit erneuerbarer Energie direkt reduziertes „grünes“ Eisen exportieren, das ist relativ gut transportierbar. Und daraus können Andere dann grünen Stahl herstellen. In Schweden machen sie es vor allem deshalb, weil sie damit mehr Geld verdienen können. Sie exportieren mit dem grünen Eisen auch ihre erneuerbaren Energien, ein interessanter Business Case.
Die Idee der verlagerten klimaneutralen Produktion ist aber doch gut?
Ja, weil man den Wasserstoff in den Mengen für eine Direktreduktion nur sehr schwer zu uns transportieren kann. Im Gegensatz zum Eisen, das mehr oder weniger ein Schüttgut ist. Wenn man darauf achtet, dass es unterwegs nicht rostet. Auch für Brasilien oder Südafrika wäre es eine Möglichkeit, damit zusätzliches Geld zu verdienen und nebenbei auch ihre heimische Stahlindustrie klimaneutral zu machen. Wenn man ohnehin in der Lage ist, das Erz grün herzustellen, kann man sich auch selbst damit versorgen. Dann könnte z. B. auch Südafrika auf das heimische Asset Kohle verzichten, weil man ja das bessere Asset Sonne und Wind besitzt. Das muss sich erst entwickeln. Aber es ist eine interessante Strategie – am Ende wird es auf eine Mischung hinauslaufen.
Notwendig ist aber auch hier eine entsprechende Technologieentwicklung?
Wenn die Technologie z. B. für die klimaneutrale Stahlherstellung hier gar nicht erst aufgebaut, weiterentwickelt und marktfähig wird, dann wird das auch in Brasilien und Südafrika nicht geschehen. Da sind die Europäer mit ihrer Kapitalverfügbarkeit, ihrem Zinssatz und Know-how in einer guten Position. Es ist also durchaus sinnvoll, auch zukünftig hier Primärstahl klimaneutral zu produzieren.
Also Vorbild Deutschland und Europa, damit Stahl und Wasserstoff weltweit klimaneutral und ressourcenschonend produziert werden können?
Ja richtig, und das nicht nur in Pilotanlagen, sondern im Industriemaßstab und möglichst wirtschaftlich erfolgreich – und dann kann man das auch anderswo. Dass wir dann einen Teil davon importieren, erscheint logisch. Allerdings besteht die Gefahr, falls der erste Schritt der Produktion hierzulande wegfällt, dass weitere Produktionsschritte verschwinden. Für die Standorte, Politik und Arbeitsplätze wird es dann schwierig.
Investoren könnten aber schon jetzt eher in andere als in deutsche Industriestandorte investieren?
Sobald sich die Technologie durchsetzt, wird es für Investoren durchaus interessant, gleich in Südafrika zu investieren. Das sieht man ja auch schon in Schweden. Da gibt es das bereits erfolgreiche „Hybrit“-Projekt der schwedischen Erz-, Energie- und Stahlproduzenten LKAB, Vattenfall und SSAB. Und an der schwedisch-finnischen Grenze in Lappland will jetzt ein Start-up Stahl produzieren. Dahinter stehen der Batteriehersteller Northvolt, aber auch Mercedes und andere.
Auf Wasserstoffbasis könnten also ganz neue Industriekonstrukte entstehen.
Bisher ist man immer davon ausgegangen, dass ein Stahlwerk nicht so einfach zu bauen ist, wie das Beispiel Thyssenkrupp in Brasilien gezeigt hat. Aber ein wasserstoffbasiertes, integriertes Werk ist technologisch einfacher. Vielleicht bauen demnächst Aphabet, Apple und Co. Stahlwerke – das könnte für traditionelle Stahlunternehmen zu einer Herausforderung werden.
Woher kommt das Erz für die Duisburger Stahlwerke?
Aus aller Welt, aber überwiegend aus Brasilien per Schiff erst über Rotterdam und von dort über den Rhein nach Duisburg. Das ist eine relativ günstige Rohstoffversorgung.
In einer hoffentlich zukünftigen funktionierenden Circular Economy (CE) werden Rohstoffe im Kreislauf geführt und nur dissipative Verluste durch neue ausgeglichen. Welche Refinanzierungsmöglichkeiten hat die Industrie, wenn wir sie rohstoffreduziert denken?
Die Welt wächst, der Wohlstand hoffentlich auch – und da benötigt man noch einiges an Stahl, Zement und Kunststoffen. Diese Grundstoffe haben global immer noch Wachstumsraten. Die aktuellen Szenarien z. B. der Internationalen Energieagentur sagen, dass wir mit der Circular Economy dieses Level stabilisieren und langfristig nach 2030, 2040 in eine Reduktion bei den Materialien eintreten. Im akuten Planungshorizont der Hersteller wächst der Weltmarkt aber derzeit eher noch, weil der Bedarf zunimmt. Erst bei einer sehr erfolgreichen CE gibt es vielleicht irgendwann kein Wachstum mehr. Wir wissen alle, dass es kein Spaß ist, in nichtwachsenden Märkten Anteile zu gewinnen, aber es geht. Wenn es gelingt, den Stahlverbrauch in Deutschland zu reduzieren, muss das in anderen Regionen noch lange nicht so sein. Da ohnehin nur rund 20 Prozent des hier produzierten Stahls am Ende in Deutschland bleiben, sollte das auch in Zukunft kein Problem sein.
Die Grundstoffindustrie sollte also mit der CE kein Problem haben?
Sehr viel weniger als die Energieindustrie, die an einer Reduzierung des Verbrauchs lange kein Interesse hatte. Der Stahl wird ja heute schon fast vollständig recycelt, auch wenn es sich dabei primär aus ökonomischen Gründen zum Teil um Downcycling handelt. Auch in der chemischen Industrie ist CE total spannend, weil letztlich die meisten chemischen Produkte auf Kohlenwasserstoffen basieren. Und die müssen nicht aus Rohöl stammen, sondern könnten mit Wasserstoff auch aus Kunststoffabfällen oder Biomasse gewonnen werden. Dadurch werden wir einen starken Druck sehen, diese dann genau dort herzustellen, wo Wasserstoff günstig ist. Wenn der Kohlenstoff dann auch noch aus der Luft gewonnen werden sollte, dann verarbeitet die chemische Industrie nur noch (erneuerbare) Energie. Die ersten arabischen Länder wollen genau da hin. Einige sind jetzt schon bei den fossilen Kohlenwasserstoffen sehr stark. Auch die nordafrikanischen Länder wie Marokko würden gern an diesem künftigen Markt partizipieren. Wir werden also vielleicht langfristig „grüne Grundstoffchemikalien“ aus diesen Ländern importieren, statt von ihnen separat solare Energie und Wasserstoff zu beziehen, um damit hier CO2 aus der Luft zu ziehen und daraus Grundstoffchemikalien zu produzieren. Sie könnten uns das viel besser kombiniert liefern, zumal die ganze Logistik steht und keine neuen Pipelines und Stromkabel benötigt werden.
Eine eigene fossile Rohstoffbasis hatte Deutschland ohnehin nie, außer bei der Kohle. Jetzt ist es importiertes Öl, das die Raffinerien hier verarbeiten.
In Zukunft wird eine zentrale Rohstoffbasis der Kunststoffmüll sein. Von dem besitzen wir eine ganze Menge. Daraus lassen sich auch über die verschiedensten Verfahren von mechanischem und chemischem Recycling neue Kunststoffe machen. Es ist also wichtig, diesen Kreislauf aufzubauen und zu schließen.
Kann man sich eine CE-Industrie vorstellen, die eher Stoffdienstleister als Rohstoffverarbeiter ist – ähnlich einer Autoindustrie, die zum Mobilitätsdienstleister wird?
Das ist eigentlich exakt das Konzept, auf das es hinausläuft. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob sich das ökonomisch so einstellen wird. Das Konzept wird schon seit 25 Jahren am Wuppertal Institut diskutiert, es ist also nicht ganz neu. Es gibt auch einzelne Beispiele von Unternehmen, die das erfolgreich praktizieren, aber in der Breite ist das so eine Sache. Ich könnte mir das eher noch beim Stahl vorstellen, also dass man Stahl nur vermietet und ihn irgendwann wieder zurückerhält. Da ist man aber auch in der Lage, den zu verfolgen. Der Produzent einer Basischemikalie, die für Plexiglasschalen, Verpackungen und Autoreifen verwendet wird, hat aber kaum die Möglichkeit, diese Ströme eins zu eins zu verfolgen und zurückzugewinnen. Es gibt sicher attraktivere Bereiche, zum Beispiel bei hochwertigen Kunststoffen wie Polypropylenen. Daraus entstehen z. B. Scheinwerfer, deren Material wertvoll für den Hersteller wäre. Sie gelangen aber eben nicht wieder zu ihm zurück, sondern landen nach 20 Jahren Nutzung irgendwo in der Welt.
Die Digitalisierung könnte derartige Probleme doch wohl lösen.
Man muss es in der Tat schaffen, die Stoffe zu verfolgen, um sie am Ende ihrer Nutzungszeit wiederzuerlangen. Und mit elektronischen Tags lässt sich feiner und effizienter sortieren, so dass die Recycler – wenn es gut läuft – viele Stoffe sortenrein an die chemische Industrie zurückgeben können.
Prof. Dr. Stefan Lechtenböhmer leitet die Forschungsabteilung Zukünftige Energie- und Industriesysteme am Wuppertal Institut, ist Professor an der Universität Lund für zukünftige nachhaltige Energiesysteme und Leiter des Kompetenzzentrums SCI4Climate.NRW, das innerhalb der Plattform IN4Climate.NRW von Industrie, Wissenschaft und Politik die Erarbeitung innovativer Strategien für eine klimaneutrale Industrie wissenschaftlich begleitet.

Das factory-Magazin Industrie lässt sich als PDF im Querformat auf allen Bildschirmen inklusive Smartphone und Tablet lesen. Das Magazin ist reich illustriert und enthält weitere Zahlen, Zitate und Wordcloud zum Thema. Enthalten sind dort alle Beiträge, im Online-Themenbereich erscheinen sie nach und nach – lassen sich dort aber kommentieren und bewerten. Der Download des factory-Magazins ist wie immer kostenlos.
Beiträge online
INDUSTRIE

- Editorial: Schnell, wenn wir es wollen
- Der Weg der Industrie
- Ideen für den Wandel
- Die Circular Economy ist der Schlüssel
- Ressourceneffizienz 4.0 für eine klimaneutrale Industrie
- Politik für die Industrietransformation
- Neue Chancen für alte Standorte
- Mit Künstlicher Intelligenz zu mehr Nachhaltigkeit in der Produktion
News zum Thema
- 04/2025 | BIP-Prognose 2025: US-Zölle drücken deutsches Wirtschaftswachstum
- 02/2025 | Expertenrat Klima: Seit 2022 mehr Energiewende, aber kein Umbau bei Verkehr, Gebäude, Landnutzung und gerechter Lastenverteilung
- 01/2025 | Stromproduktion aus Sonne und Wind in EU 2024 erstmals höher als aus Kohle und Gas
- 01/2025 | Erneuerbare Energien sorgen für günstigere Strompreise und geringere Treibhausgasemissionen
- 07/2024 | Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie auf dem Weg
- 07/2024 | Circular Design Summit mit offiziellem Start des Circo-Hub
- 06/2024 | Expertenrat Klima zur Einhaltung des Klimaziels bis 2030
- 05/2024 | Wie Unternehmen Circular Economy umsetzen können
- 04/2024 | Klimawandel führt zu Einkommensverlusten
- 03/2024 | Emissionsintensive Chemieparks in Deutschland und Wege zur Emissionsreduktion
- 02/2024 | Bundespreis Ecodesign 2024: Bewerben bis Mitte April
- 01/2024 | Treibhausgasbilanzen für die Unternehmensberichterstattung
- 01/2024 | Der andere Bauernprotest: Tausende fordern bäuerliche und ökologische Landwirtschaft
- 01/2024 | Deutschlands CO2-Emissionen sanken 2023 auf Rekordtief
- 12/2023 | Deutschlandpakt zur Planungsbeschleunigung erhält NABU-Negativpreis "Dinosaurier des Jahres"
- 12/2023 | Effizienz-Preise NRW für Elektronik-Refurbisher, Fliesenretter, Blaulicht-Lebensverlängerung und faires Lötzinn
- 12/2023 | Bundespreis Ecodesign 2023 prämiert zwölf Vorreiterprojekte für ökologische Produkte und Services
- 11/2023 | Öl- und Gaskonzerne könnten für Klimaschäden zahlen und dennoch profitieren
- 09/2023 | Circular Design Summit stellt zirkuläre Produkte und Geschäftsmodelle vor
- 06/2023 | Fahrradwirtschaft: Starkes Wachstum bei Umsatz und Beschäftigung
- 05/2023 | Subventionierte Industriestrompreise führen nicht zu klimaneutraler Produktion
- 05/2023 | UN: Schutz der biologischen Vielfalt zügig umsetzen
- 05/2023 | Vollzeitarbeitende wünschen sich Viertagewoche
- 04/2023 | Weitere Studie: E-Fuels nicht sinnvoll für großflächigen Einsatz bei Pkw und Lkw
- 03/2023 | RNE: Mehr Markt im Klimaschutzgesetz gefährdet gesellschaftlichen Zusammenhalt
- 03/2023 | "Letzte Warnung" des IPCC: Schnelle Emissionsreduktion nötig – und möglich
- 03/2023 | Deutsche Treibhausgasemissionen sanken 2022 um 1,9 Prozent – nötig wären sechs Prozent
- 03/2023 | Ressourcenschutz durch Reparatur: Bereitschaft da, Hürden zu hoch
- 03/2023 | Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen können Milliarden Schadenskosten vermeiden
- 01/2023 | Bundespreis Ecodesign startet Wettbewerb 2023
- 01/2023 | Sechs-Punkte-Plan für Gutes Essen für alle
- 01/2023 | Lützerath: Aktionen und Demonstrationen gegen weiteren Braunkohleabbau
- 01/2023 | Lieferkettengesetz: Sorgfalt ist nun Pflicht
- 12/2022 | EU einigt sich auf Gesetz gegen Entwaldung für bestimmte Produkte
- 12/2022 | Bundespreis Ecodesign: Projekte sind Muster für intelligente Lösungsansätze
- 11/2022 | Mit Postwachstum gegen die Polykrise
- 11/2022 | UN-Klimagipfel COP 27: Geplante Maßnahmen reichen nur für 2,5 Grad
- 10/2022 | Beeindruckende Projekte beim Bundespreis Ecodesign
- 10/2022 | Tata bringt günstiges Elektroauto für 10.000 Euro
- 09/2022 | Nachhaltige Unternehmen gehen auf die Straße
- 09/2022 | Globaler Klimastreik für #PeopleNotProfit
- 09/2022 | Schnelle Dekarbonisierung des Energiesystems spart Billionen
- 09/2022 | Unternehmen wünschen sich Regeln, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren
- 09/2022 | Wirtschaft der G7-Staaten auf 2,7-Grad-Kurs der Erderwärmung
- 09/2022 | Digitalisierung muss stärker dem sozial-ökologischen Wandel dienen
- 08/2022 | Mit Übergewinnsteuer Krisenprofite umverteilen
- 08/2022 | Ressourcen schützen heißt Menschen schützen
- 08/2022 | Wie Unternehmen mit KI nachhaltiger wirtschaften
- 07/2022 | Förderprogramm DigiRess zur Digitalisierung der Ressourceneffizienz in zirkulären Produktionsprozessen
- 07/2022 | Earth Overshoot Day 2022 ist Plädoyer für zirkuläre Unternehmen
- 07/2022 | Besser wirtschaften: Kooperativ für Gemeinwohl statt Profite
- 07/2022 | Klimakrise kostete Deutschland seit 2018 etwa 80 Milliarden Euro
- 07/2022 | Das Produktdesign der Klimaneutralität
- 07/2022 | Globaler Holzverbrauch entwaldet den Planeten
- 07/2022 | Unternehmen entwickeln Kreislaufwirtschaft in Kooperation
- 06/2022 | Was Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität beachten sollten
- 06/2022 | Verantwortungsvolle Unternehmen sollten Effizienzgewinne für weiteren Klima- und Ressourcenschutz einsetzen
- 06/2022 | Wie man die eigenen Produkte zirkulär gestaltet
- 05/2022 | Öl- und Gasindustrie setzt weiter auf Expansion statt Transition
- 05/2022 | Land kann Erneuerbare-Energie-Anlagen-Betreiber verpflichten, Bürger*innen zu beteiligen
- 05/2022 | Mit Ökobilanzen zur Ressourcenschonung: Beispiel LED-Leuchten
- 04/2022 | IPCC-Klimabericht zur Minderung des Klimawandels vergleicht Klimaschutzmaßnahmen und ihre Effizienz
- 03/2022 | Stopp russischer Energieimporte würde BIP um drei Prozent reduzieren und Energiewende beschleunigen
- 03/2022 | Globaler Klimastreik für Frieden und Klimagerechtigkeit
- 03/2022 | CO2-Emissionen in Deutschland stiegen 2021 um 4,5 Prozent
- 01/2022 | Das Design bestimmt den Verbrauch: Europaweite Ausschreibung Bundespreis Ecodesign 2022
- 01/2022 | factory-Magazin Industrie: Schneller Wandel ist möglich
- 01/2022 | EU-Taxonomie für Investitionen: Atom- und Gaskraftwerke sollen nachhaltig sein
Themen
- Kapital
- Wohlstand
- Design
- Ressourcen
- Klimaneutral
- Industrie
- Vielfalt
- Change
- Freiheit
- Steuern
- Mobilität
- Digitalisierung
- Besser bauen
- Circular Economy
- Utopien
- Divestment
- Handeln
- Baden gehen
- Schuld und Sühne
- Wir müssen reden
- Rebound
- Sisyphos
- Gender
- Wert-Schätzung
- Glück-Wunsch
- Trans-Form
- Vor-Sicht
- Trennen
- Selbermachen
- Teilhabe
- Wachstum